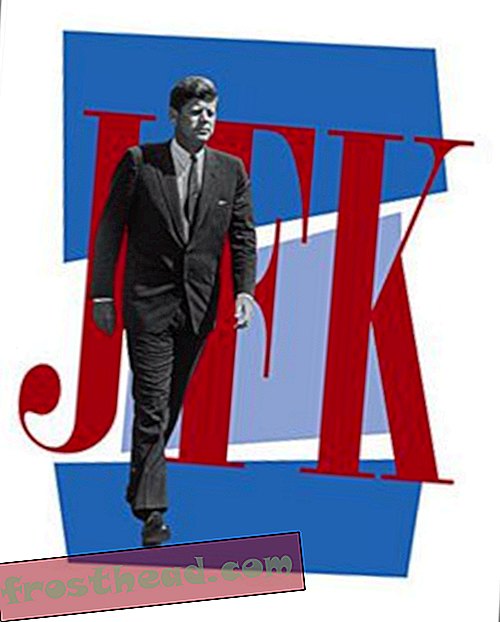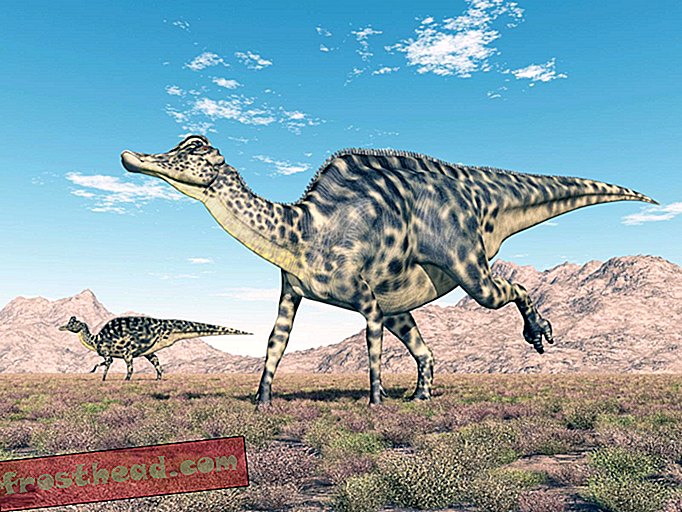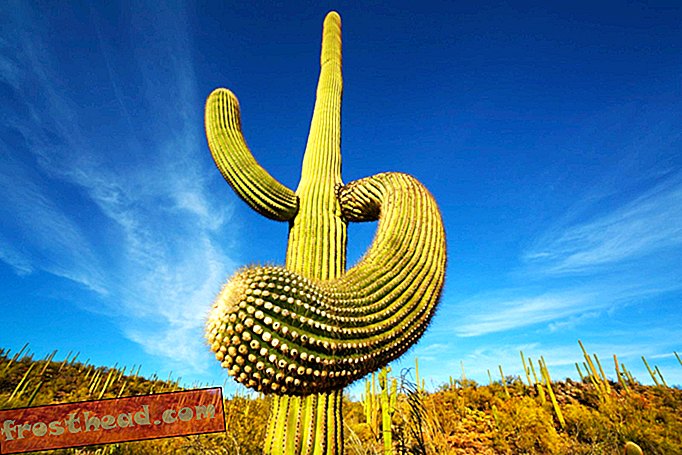In der Märzausgabe 1942 der Zeitschrift Modern Hospital veröffentlichte Charles F. Neergaard, ein bekannter New Yorker Krankenhausdesignberater, ein Layout für eine stationäre Krankenhausabteilung, das so innovativ war, dass er es urheberrechtlich geschützt hat. Der Plan sah zwei Pflegeeinheiten - Gruppen von Patientenzimmern, die von einem einzigen Pflegepersonal beaufsichtigt wurden - in einem einzigen Gebäudeflügel vor. Für jede Einheit ermöglichte ein Korridor den Zugang zu einer Reihe kleiner Patientenzimmer entlang einer langen Außenwand und zu einem gemeinsamen Servicebereich zwischen den beiden Korridoren.
Das Merkmal, das seinen Plan so innovativ und daher riskant machte? Es beinhaltete Zimmer ohne Fenster.
Ein fensterloser Raum scheint heutzutage kaum noch innovativ zu sein, aber in den vierziger Jahren war es ein schockierender Vorschlag für einen Patientenflügel. Es verstieß gegen ein langlebiges Verständnis der Rolle des Krankenhausgebäudes im Hinblick auf die Förderung der Gesundheit.
Fast zwei Jahrhunderte lang hatten Krankenhausdesigner ihre Entwürfe auf eine Grundannahme gegründet: Um krankheitsfrei und gesundheitsfördernd zu bleiben, benötigten Krankenhausräume direkten Zugang zu Sonnenlicht und frischer Luft. Diese Regel war das Ergebnis einer jahrhundertealten Überzeugung, dass Krankheit durch dunkle, stehende Räume, in denen sich schlechte Luft - stinkende, unreine, stehende, mit Partikeln beladene Luft - ansammelte, verbreitet oder vielleicht sogar direkt verursacht werden könnte.
Im späten 18. Jahrhundert war diese Korrelation statistisch gesichert. Epidemien treffen die Mieter von überfüllten, verarmten Stadtvierteln immer härter als die Bewohner von luftigeren, wohlhabenderen Stadtvierteln. Patienten in großen städtischen Krankenhäusern litten weit häufiger unter Kreuz- und Sekundärinfektionen als Patienten in ländlichen oder Kleinstadtkrankenhäusern. Es war allgemein bekannt, dass fensterlose Räume, die keine direkten Krankheitserreger darstellten, die Bedingungen hervorbrachten, die zu Krankheiten führten.
In Anbetracht dieser Korrelation hatte vor dem 20. Jahrhundert jeder einzelne Raum innerhalb eines Krankenhauses normalerweise Zugang zum Freien. Flure hatten Fenster. Wäscheschränke hatten Fenster. In einigen Krankenhäusern hatten sogar die Lüftungskanäle und Gehäuse für Rohrleitungen und Steigleitungen Fenster. Die Fenster in Patientenzimmern und Operationssälen waren so groß, dass die Blendung Probleme verursachte - Patienten wach zu halten und Chirurgen während der Operation vorübergehend blind zu machen.
Fortschritte in medizinischen Theorien und Praktiken im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert veränderten den Glauben an Fenster, löschten ihn jedoch nicht aus. Mit der Entwicklung der Keimtheorie hatten Sonnenlicht und Frischluft neue Zwecke. Versuche haben gezeigt, dass ultraviolettes Licht keimtötend ist. Fenster aus klarem Glas oder sogar aus speziellem „Vita-Glas“, das die UV-Strahlen nicht blockierte, waren also ein Mittel zur Dekontamination der Oberfläche.
In ähnlicher Weise haben Aufzeichnungen über Tuberkulose-Sanatorien bewiesen, dass eine einfache Exposition an die frische Luft heilsam sein kann. Das Krankenhausgebäude selbst war eine Form der Therapie. In einer Ausgabe des Architekturmagazins Pencil Points aus dem Jahr 1940 stellte Talbot F. Hamlin mit Zuversicht fest, dass „die Qualität der Umgebung des Kranken für die Heilung ebenso wichtig sein kann wie die spezifischen therapeutischen Maßnahmen selbst“.
Aber die Umgebung war zum Teil wichtig, weil sie in erster Linie in Krankenhäuser ging. In der Tat war medizinische Behandlung bis zum Ende des 19. Jahrhunderts nicht der Grund, in ein Krankenhaus zu gehen - Armut war der Grund. Die überwiegende Mehrheit der Krankenhauspatienten des 19. Jahrhunderts waren Wohltätigkeitsfälle - kranke Menschen, die sich keinen Hausbesuch bei einem Arzt leisten konnten, keine Familie hatten, um die sie sich kümmerten, und keinen anderen Ort hatten, an den sie gehen konnten. Ein Patient würde wochenlang, manchmal sogar monatelang, dasselbe Bett in einer Krankenstation belegen, in der sich ein halbes Dutzend bis 30 Patienten befanden. Der Arzt machte einmal am Tag Runden. Krankenschwestern versorgten sie mit Essen, wechselten die Verbände, säuberten sie und wechselten die Bettwäsche - aber sie leisteten nur sehr wenig in Bezug auf die praktische Behandlung. Die peinlich sauberen, hellen und luftigen Räume des Krankenhauses waren ein Gegenmittel gegen die Wohnumgebung, aus der verarmte Patienten kamen.
In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts veränderte sich jedoch die Bevölkerung der Krankenhäuser. Fortschritte in der Medizin, städtebauliches Wachstum und philanthropische Veränderungen machten Krankenhäuser zu einer neuen Art von Einrichtung, in der sich Menschen aller Klassen auf dem neuesten Stand der Behandlung befanden. Anästhesie und Asepsis machten Krankenhausoperationen nicht nur sicherer, sondern auch erträglicher. Neue Geräte wie Röntgengeräte, Ophthalmoskope und Kardiographen verbesserten die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten. Bakteriologische Labortechniker konnten Krankheitserreger mit einer Gewissheit identifizieren, die in der vorangegangenen Ära der symptomatischen Diagnose ungeahnt war. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ging es in Krankenhäusern zunehmend um medizinische Verfahren und effiziente Arbeitsabläufe, nicht um die scheinbare Gesundheit der Umwelt an sich.
Diese Änderungen machten die Grenzen der früheren „therapeutischen“ Krankenhausentwürfe deutlich. Um in jedem Raum ein Fenster zu haben, dürfen Gebäude nicht breiter als zwei Räume sein. Dies erforderte zwangsläufig mehrere lange schmale Flügel. Solche weitläufigen Strukturen waren teuer zu bauen, unerschwinglich teuer zu heizen, zu beleuchten und mit Wasser zu versorgen und ineffizient und arbeitsintensiv zu betreiben. Lebensmittel erreichten die Patienten kalt, nachdem sie aus einer entfernten zentralen Küche transportiert worden waren. patienten, die operiert werden mussten, wurden durch zahlreiche gebäude in den chirurgischen raum gebracht.
Krankenhausdesigner begannen daher, Praktiker, Räume und Geräte effektiver anzuordnen. Die Schlagworte änderten sich von „Licht“ und „Luft“ zu „Effizienz“ und „Flexibilität“. Die Betonung der Effizienz eroberte rasch die Versorgungsbereiche des Krankenhauses. Zeit- und Bewegungsstudien bestimmten die Anordnung und den Ort von Küchen, Wäsche und zentraler Sterilgutversorgung. Diagnose- und Behandlungsräume wurden neu gestaltet, um effiziente, aber aseptisch sichere Wege für die Bewegung von Patienten, Krankenschwestern, Technikern und Verbrauchsmaterialien zu schaffen.
Das Design der stationären Abteilungen blieb jedoch zunächst unverändert.
Krankenhausdesigner und -praktiker befürchten, dass Patientenbereiche, die auf Effizienz und nicht auf Gesundheit ausgelegt sind, die Behandlung verlängern, die Genesung behindern oder sogar zum Tod führen könnten. In einer Ausgabe des Modern Hospital von 1942 hielt es Lt. Wilber C. McLin für „undenkbar, auch die Möglichkeiten der Anwendung von Zeit- und Bewegungsstudien auf Methoden der direkten Patientenversorgung in Betracht zu ziehen.“ Die stationären Abteilungen blieben sakrosankte Tempel aus Licht und Luft.
In den 1940er Jahren waren die meisten Krankenhausgebäude daher seltsame Gemische aus effizient eingerichteten medizinischen Behandlungsräumen und ineffizient eingerichteten Pflegeeinheiten. Krankenschwestern gingen lange, offene Stationen auf und ab, in denen 20 oder mehr Patienten untergebracht waren, oder lange, doppelt beladene Korridore, die kleinere Stationen (mit sechs, vier oder zwei Betten) und Privaträume miteinander verbanden. Servicebereiche befanden sich am äußersten Ende dieses Weges. Die Grundversorgung zu sichern, war eine lange Wanderung. Schrittzähler bewiesen, dass die tägliche Distanz am besten in Meilen gezählt wurde; Einige Krankenschwestern machten durchschnittlich 8-10 pro Schicht. Der prominente Philadelphia-Arzt Joseph C. Doane bemerkte 1939 trocken, dass "einige Krankenhäuser anscheinend nach der falschen Theorie geplant sind, dass Krankenschwestern ihren Weg von entfernten Serviceräumen zu weit entfernten Betten finden, ohne dass es zu Müdigkeit kommt."
Dies war das Designdilemma, mit dem Neergaard konfrontiert war, ein ikonoklastischer aufsteigender Stern im brandneuen Beruf des „Krankenhausberaters“ (Ärzte, die Baukomitees und Architekten zu Best Practices berieten). Er schlug vor, das Design der Pflegeeinheit zu rationalisieren, die Fenster in den unverletzlichen Patientenzimmern zu belassen, die Effizienz jedoch dem direkten Zugang zu Sonnenlicht und Frischluft in den angrenzenden Serviceräumen vorzuziehen. Sein Plan sah vor, dass zwei verschiedene Pflegeeinheiten (Gruppen von Patienten, die von einer Oberschwester betreut wurden) dieselben fensterlosen zentralen Versorgungsräume gemeinsam nutzen konnten, wodurch die räumliche Redundanz verringert wurde.
Neergaard errechnete, dass dieser „Doppelpavillonplan“ nur zwei Drittel der Grundfläche einer traditionellen Pflegeeinheit beansprucht. Außerdem wurden die Serviceräume näher an die Patientenzimmer herangeführt, was die täglichen Wege einer Krankenschwester drastisch verkürzte. Sein Entwurf war ein erster Versuch, das Krankenhaus so zu behandeln, als wäre es ein anderes Gebäude. Die Struktur war ein Werkzeug, das die medizinische Versorgung erleichterte, keine Therapie an sich.
Neergaard wusste, dass seine Ideen umstritten sein würden. Im Jahr 1937 veranlasste seine Präsentation auf einem Kongress der American Hospital Association die prominenten Krankenhausarchitekten Carl A. Erickson und Edward F. Stevens, von einem Komitee zurückzutreten, anstatt Neergaards Vorschläge zu unterstützen. Ein bekannter Krankenhausarchitekt nannte den Doppelpavillonplan „im Wesentlichen einen Slum“.
Neergaards Ideen haben sich jedoch durchgesetzt. Steigende Kosten und sinkende Einnahmequellen machten die Reduzierung des Krankenhausbaus und der Betriebsbudgets zu einem fiskalischen Gebot. Das zentralisierte Design reduzierte den Aufwand für teure Außenwandkonstruktionen, erleichterte die Zentralisierung von Diensten und minimierte den Personalbedarf der Krankenschwestern, indem die Verfahrwege verringert wurden. In den 1950er Jahren, mit dem Aufkommen von Antibiotika und verbesserten aseptischen Praktiken, glaubte die medizinische Einrichtung auch, dass die Gesundheit der Patienten unabhängig von der Raumgestaltung aufrechterhalten werden könnte. Einige Ärzte zogen sogar die vollständige Umgebungskontrolle durch Klimaanlage, Zentralheizung und elektrische Beleuchtung vor. Für gesunde Krankenhäuser waren Fenster nicht mehr erforderlich, und in den 1960er und 1970er Jahren erschienen sogar fensterlose Patientenzimmer.
Die effizienten, unmenschlichen und eintönigen Gebäude der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zeugen davon, dass das Krankenhausdesign eher ein Instrument zur Erleichterung der Medizin als zur Therapie an sich wurde. Heute wird ein Aufenthalt in einem Krankenzimmer ertragen, nicht genossen.
Das Pendel schwingt jedoch immer noch. 1984 veröffentlichte der Krankenhausarchitekt Roger Ulrich einen Artikel, der einen klaren und einflussreichen Befund enthielt: Patienten in Krankenzimmern mit Fenstern verbesserten sich schneller und prozentualer als Patienten in fensterlosen Räumen.
Jeanne S. Kisacky ist eine unabhängige Wissenschaftlerin, die als Dozentin für Architekturgeschichte an der Cornell University, der Syracuse University und der Binghamton University unterrichtet hat. Ihr Buch „Aufstieg des modernen Krankenhauses: Eine architektonische Geschichte von Gesundheit und Heilung“ wurde gerade veröffentlicht.