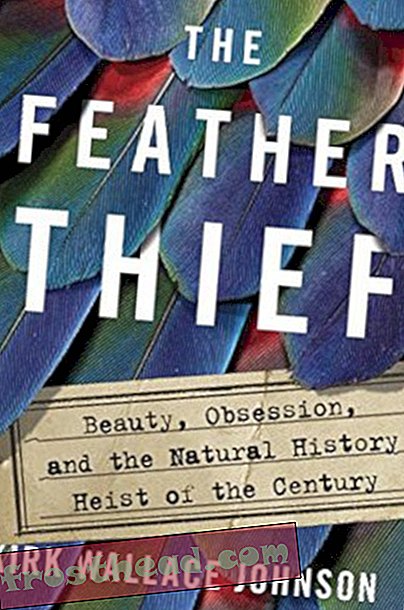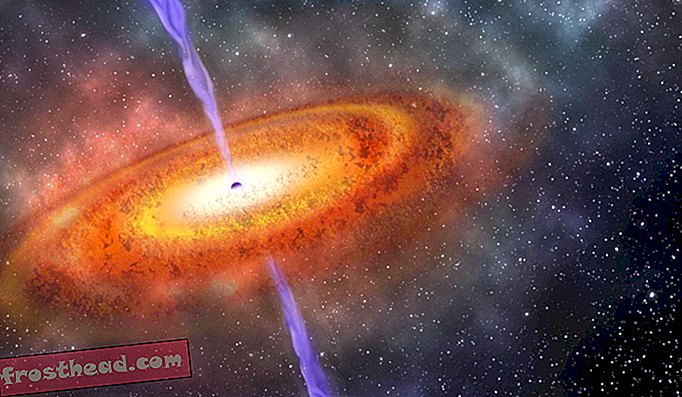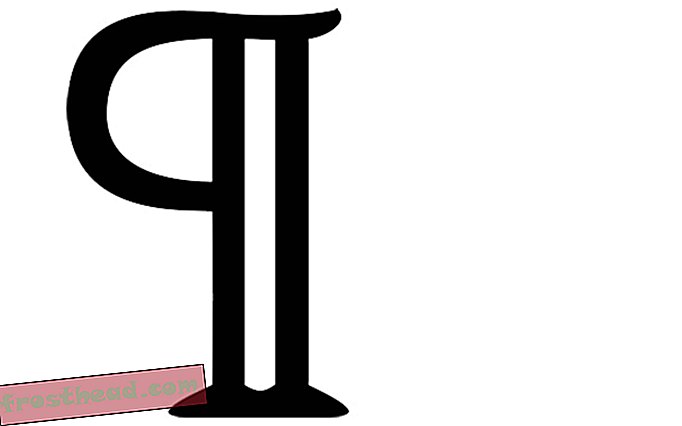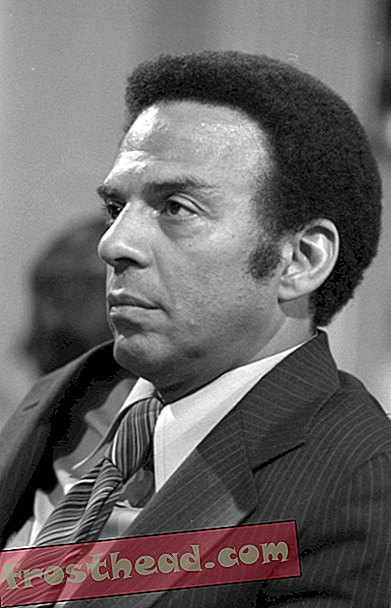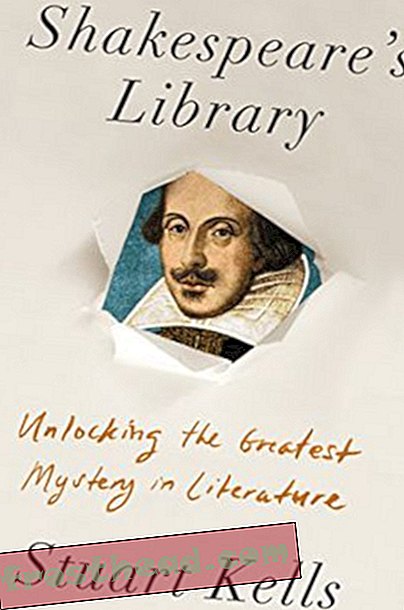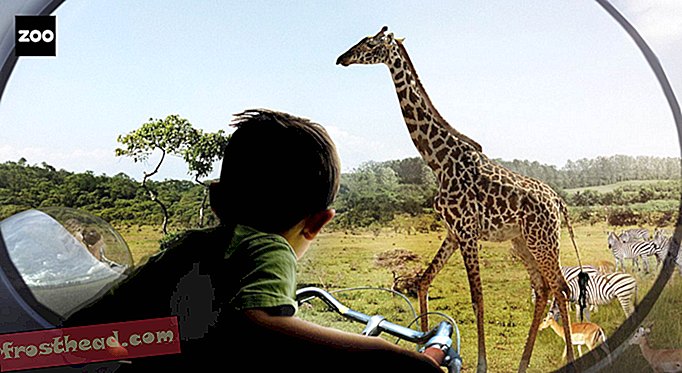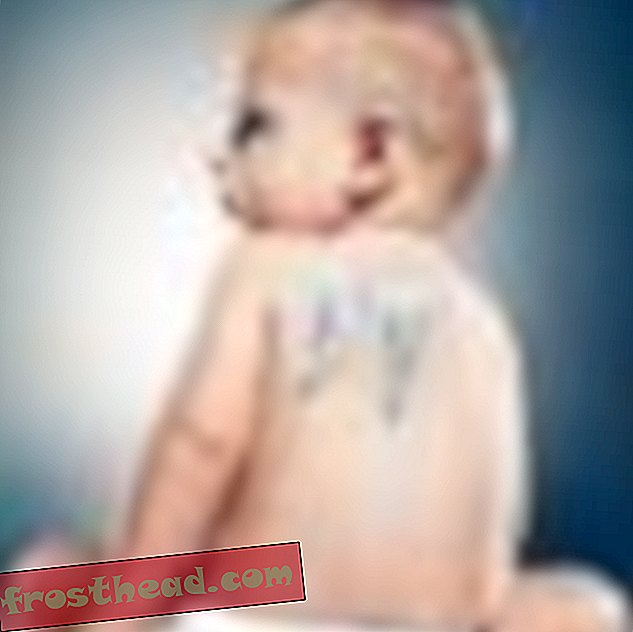Marie Jalowicz, eine in Berlin versteckte Jüdin, sah 1942 zu, wie ein Barkeeper sie für 15 Mark an einen Mann verkaufte, der auf mysteriöse Weise den Spitznamen "der Gummidirektor" trug. Wie Marie in dem kürzlich erschienenen Underground in Berlin erzählt, eine spannende Chronik ihrer Geschichte, die in ihren Worten erzählt wird, war sie verzweifelt nach einem Platz zum Schlafen. Der Barkeeper zog Marie beiseite, bevor sie mit dem Mann ging. Ihre erfundene Hintergrundgeschichte war einfach; Sie konnte es einfach nicht mehr ertragen, mit ihren Schwiegereltern zu leben. Der Barkeeper fügte hinzu, dass ihre neue Gönnerin auch "ein Nazi war, dessen Fanatismus an die Grenzen der Unordnung grenzte".
Marie hatte Gründe, über den bekennenden Nationalsozialismus des Mannes hinaus alarmiert zu sein. Der "Gummidirektor" verdiente sich seinen Spitznamen durch sein wackeliges Gangbild, und Marie hörte einmal, dass Menschen in den späten Stadien der Syphilis "so gingen, als bestünden ihre Beine aus Gummi, und sie konnten nicht mehr richtig artikulieren." Der Mann, der sie zu seinem Haus führte, stolperte über seine Worte. Und sie sollte mit diesem Mann schlafen, nur um sich zu verstecken.
Sie kamen in seiner Wohnung an, und der Mann zeigte seine Sammlung von Aquarienbehältern von Wand zu Wand. Er erinnerte sich an die Zeit, als er in einem Sanatorium war und machte ein Streichholzmodell von Marienburg, das er dem Führer widmete. Er zeigte ihr einen leeren Bilderrahmen. Marie erinnert sich:
"Irgendeine Idee, was das ist?" er fragte mich und zeigte darauf.
"Überhaupt keine Ahnung."
Selbst wenn ich es geahnt hätte, hätte ich es niemals gesagt. Schließlich enthüllte er das Geheimnis: Er hatte diesen Gegenstand mit komplizierten Mitteln und auf gewisse Kosten erworben, wie er mir sagte, und schloss die Augen. Es war ein Haar vom Deutschen Schäferhund des Führers.
Sie saßen zusammen und Marie hörte seinen Nazi-Rants zu, die immer unbehaglicher wurden, bis sie das Thema wieder auf den Fisch wechselte. Und dann hatte sie außerordentlich viel Glück: "Mit gesenktem Kopf und Tränen in den Augen sagte er, er fürchte, er müsse mich enttäuschen: Er sei zu keiner sexuellen Beziehung mehr fähig. Ich habe versucht, neutral und freundlich zu reagieren. aber ich war von einer solchen Erleichterung und einem solchen Jubel überwältigt, dass ich nicht still sitzen konnte und auf die Toilette floh. "

U-Bahn in Berlin
Ein aufregendes Stück unentdeckter Geschichte. Dies ist der wahre Bericht einer jungen Jüdin, die den Zweiten Weltkrieg in Berlin überlebt hat.
KaufenUnderground in Berlin steckt voller ähnlicher Geschichten, die die sexuelle Politik veranschaulichen, ein junges jüdisches Mädchen zu sein, das während des Zweiten Weltkriegs Schutz benötigt. Marie hat 50 Jahre lang über ihre Erfahrungen geschwiegen, aber kurz vor ihrem Tod im Jahr 1998 hat sie ihre Erinnerungen auf 77 Kassetten aufgezeichnet. In den 15 Jahren seit ihrem Tod hat Maries Sohn Hermann die Bänder transkribiert und überprüft und festgestellt, dass seine Mutter sich mit nahezu perfekter Klarheit an die Fülle von Namen und Einzelheiten ihres Lebens in Berlin erinnerte.
Acht Jahre lang hatten Marie und ihre Familie den Aufstieg Hitlers an die Macht miterlebt: Juden, die die gesetzlich vorgeschriebenen gelben Sterne auf ihren Mänteln trugen, wurden zunächst von vielen Berufen und öffentlichen Plätzen ausgeschlossen und dann zur Zwangsarbeit geschickt. Maries Mutter, die schon lange an Krebs erkrankt war, starb 1938; ihr müder, einsamer Vater Anfang 1941. Vor dem Tod ihres Vaters arbeitete Marie mit 200 anderen jüdischen Frauen bei Siemens, bückte sich über Drehmaschinen und fertigte Werkzeuge und Waffenteile für die deutsche Armee. Sie freundete sich mit einigen Mädchen an und sie rebellierten, wenn sie konnten: singen und tanzen auf der Toilette, sabotieren die Schrauben- und Nussherstellung. Als ihr Vater starb, überredete sie ihren Vorgesetzten, sie zu entlassen, da Juden nicht aussteigen durften. Sie lebte von der kleinen Summe, die sie aus der Rente ihres Vaters erhielt.
 Der vorläufige Reisepass Marie kehrte unter Johanna Kochs Namen von Bulgarien aus nach Deutschland zurück. Die deutsche Botschaft in Sofia machte diesen Pass und fügte auf einer anderen Seite einen Kommentar hinzu: "Die Inhaberin dieses Passes hat ihre Staatsbürgerschaft des Reiches nicht nachgewiesen. Sie gilt nur für ihre Rückkehr nach Deutschland über die Donauroute." (Mit freundlicher Genehmigung von Hermann Simon)
Der vorläufige Reisepass Marie kehrte unter Johanna Kochs Namen von Bulgarien aus nach Deutschland zurück. Die deutsche Botschaft in Sofia machte diesen Pass und fügte auf einer anderen Seite einen Kommentar hinzu: "Die Inhaberin dieses Passes hat ihre Staatsbürgerschaft des Reiches nicht nachgewiesen. Sie gilt nur für ihre Rückkehr nach Deutschland über die Donauroute." (Mit freundlicher Genehmigung von Hermann Simon) Im Herbst 1941, etwa ein Jahr vor ihrem Zwischenfall mit dem „Gummidirektor“, beobachtete Marie, wie ihre verbliebenen Familienangehörigen und Freunde Deportationsbefehle in Konzentrationslager erhielten, um sicher zu gehen, dass sie sterben würden. Ihre Tante Grete, eine der ersten, die geschickt wurde, bat Marie, mit ihr zu kommen. "Früher oder später werden alle gehen müssen", überlegte Grete. Mit viel Mühe sagte Marie nein. "Du kannst dich nicht retten. Aber ich werde alles tun, um zu überleben", sagte sie zu ihrer Tante.
Und so unternahm sie große Anstrengungen, um sich zu schützen. Marie entfernte ihren gelben Stern und nahm die Identität einer engen Freundin an, Johanna Koch, 17 Jahre älter als Marie. Marie behandelte Kochs Papiere mit Tinte und fälschte von Hand einen Genehmigungsstempel, tauschte das Foto auf dem Personalausweis aus und nannte sich Aryan. Manchmal führte ihre Täuschung auch dazu, dass sie Geliebte und Freunde als Mittel zum Überleben ansah.
Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs 1938 lebten Marie und ihr Vater bei Freunden, den Waldmanns. Maries Vater und Frau Waldmann hatten eine Affäre, und die 16-jährige Marie übernahm es, mit Herrn Waldmann zu schlafen, um die Chance zu verringern, dass er Marie und ihren Vater verärgert auf die Straße schicken würde.
Später fand sie in der Hoffnung, nach Shanghai auszuwandern, einen in Berlin lebenden Chinesen, der sich bereit erklärte, sie zu heiraten: "Privat dachte ich: Wenn ich einen chinesischen Pass durch ihn bekommen könnte, wäre das ausgezeichnet, aber das ist keine Beziehung, die wird zu etwas kommen. " Aber selbst nachdem sie sich um eine Heirat beworben hatte und sich eine Geschichte über eine Schwangerschaft ausgedacht hatte, konnte sie vom Büro des Bürgermeisters keine Erlaubnis erhalten, ihn zu heiraten.
Als Marie sich in der Wohnung der Putzfrau eines Freundes versteckte, traf sie einen Bulgaren namens Mitko, einen Nachbarn, der vorbeikam, um das Haus zu bemalen. Die beiden liebten sich sofort und planten zu heiraten. Marie schafft es mit Mitko nach Bulgarien, und er findet einen korrupten Anwalt, der sie möglicherweise dazu bringen könnte, legal im Land zu bleiben.
"Sie sind hier mit dieser bezaubernden Dame aus Deutschland?" [der Anwalt] fragte meinen Geliebten.
"Ich könnte sie als Gouvernante für meinen kleinen Jungen gebrauchen! Die Papiere würden nichts kosten, wenn Sie meinen Sinn verstehen", zwinkerte er vulgär.
Mitko, ein naiver, aber anständiger Charakter, war über diesen unangebrachten Vorschlag empört. "Wir können auf Ihre Dienste verzichten", sagte er schroff und stand auf und ging.
"Wie du willst", rief der Anwalt ihm nach. "Wir werden sehen, was daraus wird."
Der Anwalt übergab sie der bulgarischen Polizei, und Marie wurde allein nach Berlin zurückgeschickt. Mitko blieb mit seiner Familie zurück und war müde von den Wochen, die er zum Schutz von Marie und sich selbst unternommen hatte. Bei ihrer Rückkehr wurde sie gebeten, darauf zu warten, dass die Gestapo ihren „ungewöhnlichen Pass“ genehmigte. Sie entkam der Gestapo knapp, indem sie vorgab, einem Dieb nachzulaufen. In dieser Nacht, wo sie nirgends bleiben kann und ein Badezimmer "für die vollen Arbeiten" braucht, entlastet sie sich von der Fußmatte einer Familie mit einem "Nazi-Ring".
 Marie und ihr Ehemann Heinrich Simon 1948, kurz nach ihrer Hochzeit (mit freundlicher Genehmigung von Hermann Simon)
Marie und ihr Ehemann Heinrich Simon 1948, kurz nach ihrer Hochzeit (mit freundlicher Genehmigung von Hermann Simon) Maries packende, spannende Geschichte fängt die Düsterkeit und die Angst ein, im Krieg in Berlin allein zu sein und den Kampf ums eigene Überleben. Ihr Wille und ihr Witz spiegeln die Entschlossenheit und den Optimismus anderer Berichte über den Holocaust wider, wie die der Tagebuchschreiber Viktor Frankl und Anne Frank. Die Szenen des sexuellen Handels und der Geschlechterpolitik beleuchten jedoch eine unermessliche Realität des Überlebens als jüdische Frau im Berliner Untergrund. Marie erzählt diese Geschichten, in denen Sex ein Mittel ist, um am Leben zu bleiben, eine Transaktion mit Gleichgültigkeit, mit dem Gefühl, dass sich alles gelohnt hat.
Es sind nicht nur Bettgenossen, die ihr helfen. Marie findet Zuflucht bei nichtjüdischen Freunden, die sich für ihren Schutz einsetzen, bei Menschen, die ihr Vater kannte, und bei anderen Juden, die Schwierigkeiten haben, in Berlin zu leben. Ein Freund stellt sie Gerritt Burgers vor, einem "verrückten Holländer", der Marie in seine Wohnung brachte und dies seiner Wirtin, einer Nazi-Anhängerin namens Frau Blase, mitteilt
"Er hatte eine Frau gefunden, die gleich zu ihm kam, um bei ihm zu wohnen. Ich würde ihm das Haus behalten, und er sagte, ich wäre auch bereit, Frau Blase jederzeit zur Hand zu gehen. Da ich nicht rassistisch einwandfrei war, würde es sein Ich sollte besser nicht bei der Polizei gemeldet werden, fügte er beiläufig hinzu. Das kam der alten Frau nicht so vor, aber sie fing sofort an, mit Burgers über die Miete zu feilschen. "
So beginnt eine andere Situation, in der Marie als Handelsgut behandelt wird. Als die Vermieterin auf Burgers wütend wird, weil er ein Chaos angerichtet hat, droht sie Marie mit der Gestapo anzurufen. Als Burger Marie lesen sieht, schlägt er sie mit seinem Schuh und sagt zu ihr: "Du darfst nicht lesen, wenn ich zu Hause bin. Du sollst nur für mich da sein." Sie ist wütend, aber sie streckt es aus; Sie muss. Sie gewöhnen sich aneinander.
Solange Marie in der Wohnung lebte, die vermeintliche Frau eines Fremden, ist ihr Leben halbwegs normal, und sie profitiert vom Austausch ihrer Arbeit und tut so, als ob sie die Gesellschaft und die Sicherheit liebt. Frau Blase und Marie teilen sich das Essen und Marie erledigt Besorgungen. Blase erzählt ihre Lebensgeschichte, erzählt von ihrer schwierigen Ehe, dem Tod ihres Sohnes. Marie entwickelt einen ambivalenten Eigensinn: "Ich hasste Frau Blase als abstoßende, kriminelle Erpresserin mit nationalsozialistischen Ansichten, aber ich liebte sie als Mutterfigur. Das Leben ist kompliziert."
Hermann, Maries Sohn, erzählt die Nachkriegsgeschichte seiner Mutter in einem Nachwort. Marie überlebt den Krieg nach einer langen Reise des äußersten Glücks mit sympathischen, großzügigen Fremden, darunter eine kommunistische Gynäkologin und eine Zirkusartistin. Sie ist arm und kann nirgendwo hingehen. Anschließend unterrichtete sie an der Humboldt-Universität zu Berlin und zog eine Familie auf. Sie hat ihr Versprechen an ihre Tante Grete eingelöst, um zu überleben. Sie wusste die ganze Zeit, dass "andere Tage kommen würden" und sie "sollte der Nachwelt sagen, was geschah".