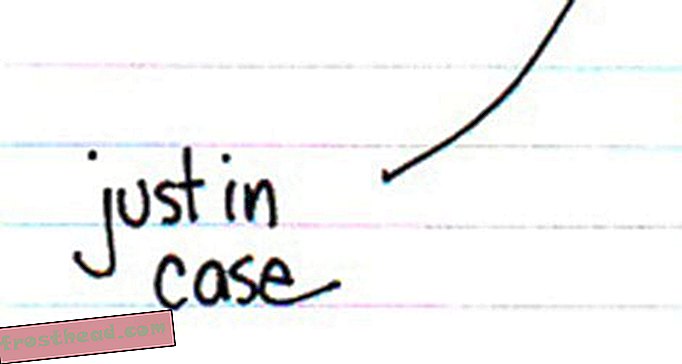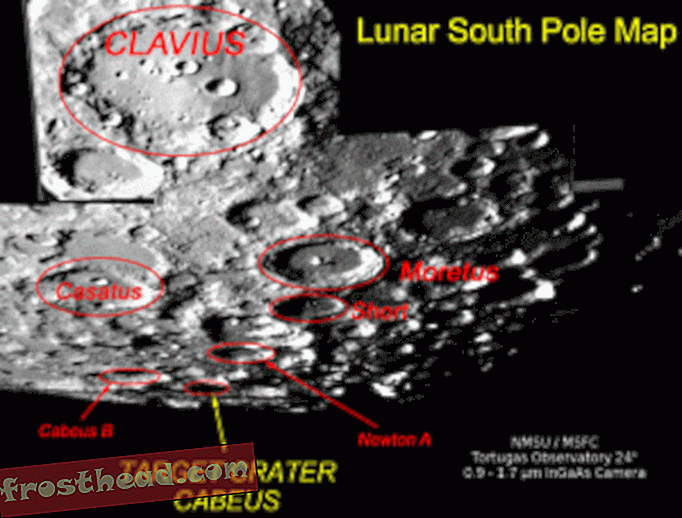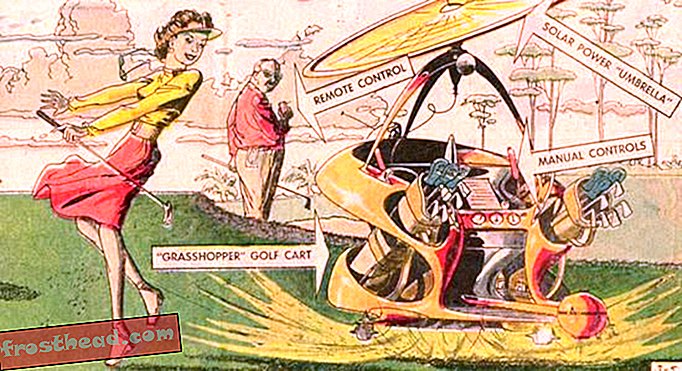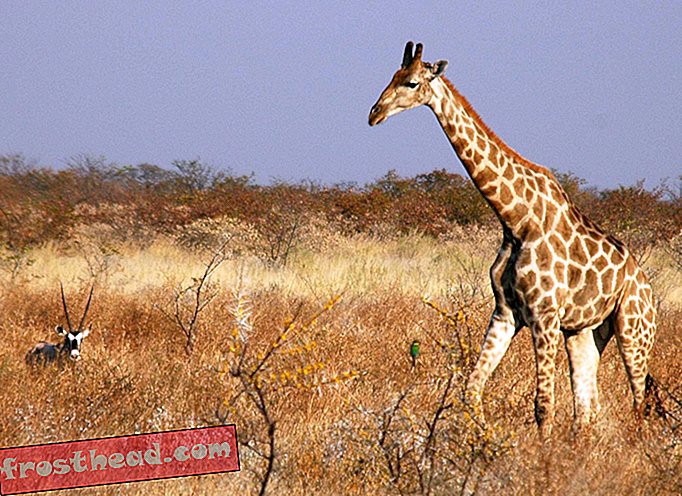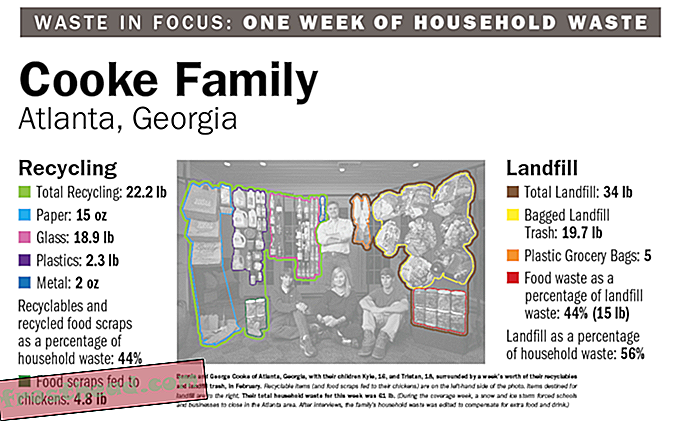Ungefähr drei Jahrzehnte vor dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches hat ein unbekannter Fotograf ein Schwarzweißbild einer überfüllten Straße in der damals als Konstantinopel bekannten Stadt aufgenommen. Die Aufnahme von 1890 malt das Bild einer blühenden Metropole: Männer in Fezzen und Melone bahnen sich ihren Weg durch die Menge, Pferde warten geduldig am Straßenrand, eine Frau in einem kahlen Schleier schreitet auf die Kamera zu und die Flagge des Imperiums hängt stolz an den Gebäuden diese Linie die Straße.
Dieses Foto gehört zu 6.000 Bildern aus dem Osmanischen Reich, die kürzlich vom Getty Research Institute digitalisiert wurden, wie Deena ElGenaidi von Hyperallergic berichtet. Der französische Geschäftsmann Pierre de Gigord, der in die Türkei gereist war, um Fotos aus dem gefallenen Reich zu entdecken, sammelte in den 1980er Jahren die umfangreiche Sammlung mit so unterschiedlichen Medien wie Albumin-Drucken, Glasnegativen und Laternenrutschen. Die Sammlung befindet sich im Getty Research Institute. In einem Blogbeitrag wurde darauf hingewiesen, dass die Bilder „schwer zu finden sind, da sie in den Gewölben mit begrenzter Auflage aufbewahrt werden“. Nach der Digitalisierung ist die Sammlung jedoch leicht zugänglich an alle, die in die Zeit der Osmanen zurückversetzt werden wollen.
Die Bilder stammen aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert, als die Macht des sich über 600 Jahre erstreckenden Reiches nachließ, als es im 16. Jahrhundert seinen Höhepunkt erreichte. Die Sammlung konzentriert sich auf kulturelle und urbane Bilder, die hauptsächlich in Konstantinopel aufgenommen wurden, und umfasst die Arbeit von mehr als 165 Fotografen, Studios und Verlegern.
Eines der beeindruckendsten Bilder in der Sammlung ist ein umfassendes, 10-teiliges Panorama der Skyline von Konstantinopel, das aus verschiedenen Fotografien zusammengesetzt wurde. Dank des Digitalisierungsprojekts können Sie jetzt das Panorama in seiner Gesamtheit sehen. Außerdem sind 50 handkolorierte Dias mit Motiven wie einer Gruppe türkischer Falkner, einem Brunnen in Konstantinopel und einem Kronleuchter in einer Moschee zu sehen. "Um die Jahrhundertwende projizierten die Menschen diese Dias zur persönlichen Unterhaltung auf eine Leinwand in Bildungseinrichtungen oder in Privathäusern, sodass sie zu Sesselläufern wurden", schreibt Getty in seinem Blogbeitrag. "Durch diese Bilder lernten sie türkische Frauen und Männer, Handwerk und Gewerbe, die Wahrzeichen der osmanischen Hauptstadt, Regierungsfunktionäre und die Geopolitik der Region kennen."
Ebenfalls in der neu digitalisierten Sammlung enthalten sind 60 Fotoalben von Reisenden des Imperiums. Eines dieser Alben wurde zwischen 1917 und 1918 von einem unbekannten deutschen Militäroffizier zusammengestellt, der seine Bilder seiner „geliebten Pauline“ widmete. Die Seiten des Albums sind mit Bildern des Alltags geschmückt: Marktverkäufer, friedliche Straßen in der Stadt, eine Frau, die starrt mit einem Lächeln in die Kamera. Die Fotos zeugen aber auch von einem dunklen Kapitel der Weltgeschichte. Das Osmanische Reich war während des Ersten Weltkrieges mit Deutschland verbündet und Tausende deutscher Soldaten wurden während des Konflikts auf osmanisches Territorium geschickt. Sie waren anwesend, als muslimische Türken 1915 einen Völkermord an christlichen Armeniern begannen und bis zu 1, 5 Millionen Menschen massakrierten. Eines der Fotos im Offiziersalbum zeigt tatsächlich Enver Pasha, einen Hauptinitiator des Völkermords.
Viele Bilder in der Gigord-Sammlung wurden von Fotografen europäischer Herkunft aufgenommen. Aber auch Fotografen armenischer, syrischer und griechischer Abstammung sind vertreten, was die große Reichweite des Osmanischen Reiches widerspiegelt und die Gemeinschaften bestätigt, die innerhalb seiner Grenzen lebten, bevor sie sich trennten oder durch Verfolgung dezimiert wurden. Die Sammlung bietet somit einen Einblick in eine Reihe von Welten.
Laut Getty wirft die Sammlung nicht nur ein Licht auf die Vergangenheit, sondern gibt dem Betrachter auch einen Einblick in die Gegenwart und ermöglicht es ihm zu beobachten, „wie sich bestimmte Orte und Menschen sowie soziale oder politische Probleme entwickelt haben und noch immer bestehen das Gleiche."